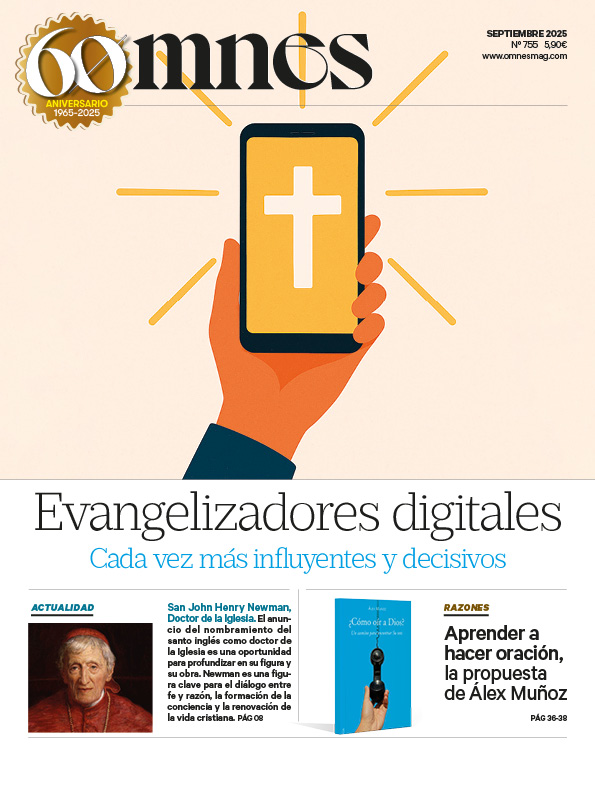Im vergangenen April jährte sich der Todestag des Heiligen Johannes Paul II. zum zwanzigsten Mal. Seine Gestalt hat tiefe Spuren in der jüngsten Geschichte der Kirche und der Welt hinterlassen. Der Dichter und Dramatiker, Philosoph und Theologe war ein Mann von außerordentlicher Kultur, ein anerkannter und geachteter moralischer Führer, ein volksnaher Seelsorger, ein lebendiges Zeugnis des menschgewordenen Glaubens.
Zu Lebzeiten war er ein Märtyrer, doch nach seinem Tod erfuhr er einen beispiellosen Zuspruch in der Bevölkerung, die seine sofortige Erhebung zu den Altären forderte. Sechs Jahre nach seinem Tod wurde er seliggesprochen und innerhalb eines Jahrzehnts heiliggesprochen. Sein langes Pontifikat hat ein umfangreiches Lehrwerk hinterlassen, das in den letzten Jahrzehnten ausgiebig erörtert und behandelt worden ist. Es gibt jedoch noch weitere Perspektiven, die es zu erforschen gilt. Dieser Artikel schlägt eine davon vor, indem er diesen heiligen Papst als Förderer der Suche nach der Wahrheit, dem Guten und dem Schönen als einen Weg zur Re-Christianisierung der Kultur darstellt, indem er sie von einem christozentrischen Humanismus inspiriert.
Eine polyphone Orgel für eine anthropologische Sinfonie
Die intellektuelle und pastorale Bedeutung von Karol Wojtyła/Johannes Paul II. ist im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen, wie die zahlreichen Veröffentlichungen zeigen, die auch nach seinem Tod erscheinen. Sein Hauptengagement - zunächst als Priester und Universitätsprofessor, dann als Oberhirte der Weltkirche - lässt sich in dem sich gegenseitig bereichernden Dialog zwischen der christlichen Offenbarung und der Moderne (oder besser gesagt, Postmoderne) zusammenfassen, insbesondere in den Bereichen Anthropologie, Ethik und Kultur. Eine solche Herausforderung deckt sich voll und ganz mit dem Anliegen, das das Zweite Vatikanische Konzil im gleichen Sinne zum Ausdruck gebracht hat, wie aus den ersten Ziffern der Pastoralkonstitution hervorgeht Gaudium et SpesDer damalige junge Erzbischof von Krakau war aktiv an der Ausarbeitung des Dokuments beteiligt.
Von dieser Herausforderung bewegt, machte sich Karol Wojtyła daran, eine personalistische und transzendente Anthropologie zu entwickeln, die auf einer soliden aristotelisch-thomistischen Grundlage basiert und mit einem phänomenologischen Ansatz angereichert ist, um den Anforderungen der Moderne - Subjektivität, Freiheit und Autonomie, Gewissen - aus einer christlichen Perspektive zu entsprechen. Auf dieser Grundlage entwickelt er eine Ethik der Person und der Kultur, die auch seine Theorie des menschlichen Handelns widerspiegelt (die Person projiziert sich in ihren Handlungen; das menschliche Handeln hat eine transformierende, d.h. humanisierende Wirkung).
Später, während seines Petrusamtes, setzte er sein Engagement für die Klärung der christozentrischen Wirklichkeit des Menschen und der Welt fort und schlug so einen neuen und regenerierenden Humanismus vor, der den Richtlinien des letzten ökumenischen Konzils entsprach.
Wissenschaftler, die sich mit Wojtyłas Leben und Werk befasst haben, haben vor allem die tiefe Einheit und Kohärenz seines Denkens hervorgehoben, das in einer ebenso mächtigen wie vielseitigen Persönlichkeit zum Ausdruck kommt: Dichter, Dramatiker, Philosoph, Theologe und Seelsorger. Wie Massimo Serreti in den ersten Jahren seines Pontifikats schrieb, "erlaubt es diese Vielgestaltigkeit des Denkens - die in unserer heutigen Kulturlandschaft recht ungewöhnlich ist - Wojtyła, sich der Wahrheit über den Menschen und der Wahrheit über Gott von unterschiedlichen visuellen Ebenen und Blickwinkeln aus zu nähern, die am Ende jedoch überraschend zusammenfließen".
Esta misma opinión otro experto en su figura, Lluís Clavell, para quien las obras de Wojtyła «proceden del interior del sujeto único e irrepetible, pero según varios registros, tales como el sonido de un órgano a lo largo de un concierto». Se trata de una metáfora muy acertada. El propio san Juan Pablo II la utilizará en una carta al profesor Giovanni Reale, responsable de la edición crítica de sus obras filosóficas en italiano. En ella defendía cómo la verdad sobre el ser humano y sobre el mundo puede explorarse tanto a través del arte (música, poesía, pintura) como de la reflexión filosófica o teológica, de modo que, entre todos estos modos de expresión podemos obtener «una suerte de singular ‘sinfonía’ antropológica, en la cual la vena inspiradora que fluye del perenne mensaje cristiano (…) orienta a todas las culturas para mayor gloria de Dios y del hombre, inseparablemente unido al misterio de Cristo».
Und er fügte hinzu: "Ich danke dem Herrn, der mir die Ehre und die Freude gegeben hat, an diesem kulturellen und spirituellen Unterfangen teilzunehmen: zunächst mit meiner jugendlichen Leidenschaft und dann, im Laufe der Jahre, mit einer Herangehensweise, die durch den Kontrast mit anderen Kulturen und vor allem durch die Erforschung des immensen lehrmäßigen Erbes der Kirche immer reicher wurde".
Der Weg der Transzendentalisten
Dieser anthropologische und ethische Vorschlag, den Karol Wojtyła/Johannes Paul II. unterbreitet, kann unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert werden. Einer davon besteht darin, ihn durch das Prisma der Transzendenzen des Seins zu beleuchten - insbesondere durch die verumdie bonum und die pulchrum-. Gewiss, dieser heilige Papst hat sie nicht monographisch behandelt, aber seine ständige Bezugnahme auf sie ist auffallend, besonders wenn er auf die anthropologische und ethische Grundlage der Person sowie auf ihre Projektion in den kulturellen und sozialen Bereich hinweist.
Inwieweit sind die Suche nach dem Guten, der Wahrheit und dem Schönen wesentlich für die Lehren dieses Denkers und Papstes? Wir können uns einige ebenso aufschlussreiche wie unbekannte Äußerungen von ihm ins Gedächtnis rufen. Eine davon fand bei einem seiner Pastoralbesuche in einer römischen Pfarrei (Santa Maria in Traspontina) statt, wo er nach dem Empfang durch einen Kinderchor die Gelegenheit nutzte, um über die Bedeutung der Erziehung zur Schönheit zu sprechen.
In dem anschließenden improvisierten Kolloquium gab Johannes Paul II. auf eine Frage hin etwas preis, das tief in seinem Herzen verankert war: "Einer von euch hat mich gefragt, was der Papst getan hätte, wenn er nicht Papst gewesen wäre (...) Auch wenn ich nicht Papst wäre, wäre es meine Hauptaufgabe, dieses Streben nach dem Guten, Wahren und Schönen zu bewahren, zu schützen, zu verteidigen, zu vermehren und zu vertiefen".
Ein Rückblick auf seine Reden bei Begegnungen mit Vertretern der Kultur, Künstlern und Kommunikatoren zeigt, dass es sich dabei nicht um eine einmalige Bemerkung handelt. So erklärte der neu gewählte polnische Papst kaum anderthalb Monate nach seiner Wahl zum Nachfolger Petri in einer Audienz mit Vertretern der Università Cattolica del Sacro Cuore in Mailand anlässlich des hundertsten Geburtstags ihres Gründers, Pater Agostino Gemelli, eindeutig, dass "die menschliche Person ihre volle Selbstverwirklichung nur in Bezug auf den Einen findet, der den grundlegenden Grund für alle unsere Urteile über das Sein, das Gute, die Wahrheit und die Schönheit darstellt". Von da an wird in zahlreichen Reden und Ansprachen an die Kultur-, Kunst- und Kommunikationsschaffenden ausdrücklich auf diese drei Transzendenzen Bezug genommen.
Das "ewige Stigma Gottes" in der Welt und im Herzen des Menschen
In der Tat schlägt Karol Wojtyła/Johannes Paul II. ausgehend vom Geheimnis des Menschen als Person, die nach dem Bild Gottes geschaffen wurde, einen aufsteigenden Weg zu Gott vor, denn, wie er sagt, "das Menschliche trägt in sich das ewige Stigma Gottes, es ist ein Bild Gottes". Die Wahrheit, das Gute und das Schöne sind nur andere Namen des höchsten und persönlichen Wesens, das wir Gott nennen, und zu dem wir aufsteigen wollen; sie sind das Ziel unserer geistigen Kräfte (Intelligenz, Wille, Zuneigung). Aus dieser Überzeugung heraus ging Wojtyła seinen eigenen intellektuellen und künstlerischen Weg, der sich auf die Phänomenologie stützt und vom Glauben erleuchtet ist. Er hatte Gelegenheit, dies in seinen Predigten vor der Kurie im Jahr 1976 zu beschreiben, die in dem Buch Zeichen des WiderspruchsDie itinerarium mentis in Deum aus den Tiefen der Geschöpfe und aus den Tiefen des Menschen.
Auf diesem Weg stützt sich die moderne Mentalität auf die Erfahrung des Menschen und auf die Behauptung der Transzendenz der menschlichen Person (...). Die Transzendenz der Person ist eng verbunden mit dem Bezug auf den Einen, der die grundlegende Basis all unserer Urteile über das Sein, das Gute, die Wahrheit und die Schönheit ist. Sie ist verbunden mit der Bezugnahme auf den Einen, der auch der ganz Andere ist, weil er unendlich ist".
Der Weg der Transzendenzen entspricht somit dem anthropologischen Bedürfnis des Menschen, sich dem Unendlichen zu öffnen, nach dem er aufgrund seiner eigenen rationalen und geistigen Natur strebt. Diese Kategorien oder Dimensionen des Seins (das Wahre, das Gute, das Schöne) bilden die Hauptfäden des Rahmens, der den Menschen (Geschöpf, teilhabendes Wesen) mit Gott (Schöpfer, Wesen des Wesens) verbindet, dank seines Zustandes der Imago Dei. Wojtyła selbst hat versucht, diesem dreifachen Weg durch Kunst, Philosophie und Theologie zu folgen, in der Überzeugung, dass alles, was wirklich menschlich ist, die Prägung durch Gott widerspiegelt. Auf diese Weise wird, wie Wojtyła selbst feststellt, "das itinerarium mentis in Deumals "Weg des Denkens des ganzen Menschen", wird schließlich zu einem echten "Weg des ganzen Menschen", einem echten "Weg des ganzen Menschen".itinerarium hominis".
Dieser Weg der Wahrheit, des Guten und des Schönen ist in einzigartiger Weise geeignet, das christliche Fundament einer Gesellschaft und einer Kultur wiederherzustellen, die sich von Gott und vom Menschen selbst entfernt haben und in gewisser Weise in Selbstzerstörung und Verzweiflung verfallen sind. Angesichts der Krise der Metaphysik - und der daraus resultierenden Zersplitterung oder Uneinigkeit zwischen den Transzendenzen -, die von der modernen Philosophie herbeigeführt wurde, hat der heilige Johannes Paul II. die metaphysische Grundlage der Philosophie wiederhergestellt und eine personalistische und transzendente Perspektive vorgeschlagen, aus der sich wiederum ein ethischer Vorschlag ableitet, der gleichermaßen in der menschlichen Person und in ihrer Transzendenz verankert ist. In diesem Sinne wollte Papst Wojtyła diese enorme kulturelle und anthropologische Herausforderung, auf die sich das Zweite Vatikanische Konzil bezog, annehmen und hat eine solide anthropologische und ethische Antwort auf die vom modernen Denken aufgeworfenen Fragen gegeben.
Ein Lebens- und Unterrichtsprojekt
Karol Wojtyła/Johannes Paul II. hat sein Leben diesem Weg gewidmet, mit Beständigkeit, Überzeugung und Festigkeit. Er wurde zunächst in seiner Zeit als Philosoph und Professor für Ethik von einem eher anthropologischen Standpunkt aus dargelegt, entwickelte sich aber im Laufe seines Pontifikats weiter und wurde auch aus einer theologischen (christologischen und trinitarischen) Perspektive betrachtet. Konkret bekräftigt er nachdrücklich die Notwendigkeit, die kulturellen, künstlerischen und kommunikativen Ausdrucksformen auf die Transzendenz des Seins zu gründen. Die Kultur ist die Verkörperung der spirituellen Erfahrungen eines Volkes", sagt er bei einer Gelegenheit, "und verleiht der Wahrheit, dem Guten und dem Schönen konkreten Ausdruck". In der Tat führt die Suche nach dem wahren und schönen Guten den Menschen zu einer Begegnung mit Gott und mit der tiefsten Wirklichkeit seines eigenen Seins.
In dem Maße, in dem der Mensch sich selbst in seinem Werk projiziert, kann er dazu beitragen, dass dieser Weg auch von denen beschritten wird, die das betrachten, was aus seinen Händen stammt oder die Frucht seiner Intelligenz oder seines schöpferischen Talents ist. Die kulturellen und künstlerischen Manifestationen und die durch die Medien und die Unterhaltung verbreiteten Inhalte sind daher ein idealer Kanal für "eine stärkere kulturelle Ausstrahlung der Kirche in dieser Welt auf der Suche nach Schönheit und Wahrheit, nach Einheit und Liebe". Diese anthropologische Suche wird auch zu einer christologischen Begegnung, denn Jesus Christus ist das Modell, nach dem der Mensch geschaffen wurde, und als der Weg, die Wahrheit und das Leben ist er auch die volle Manifestation von Schönheit, Wahrheit und Güte.
"Ich trage deinen Namen in mir"
Sein ganzes Leben lang hat dieser heilige Papst persönlich diese drei Wege der Schönheit (durch die Pflege der Poesie und des Theaters), der Vernunft (in seiner philosophischen Facette) und des Glaubens (als Theologe) beschritten, unerschütterlich in seiner Entschlossenheit, die göttlichen Spuren im Menschen und in der Schöpfung zu finden (die pulchrumdie verum und die bonum), um von dort aus jene anthropologische "Symphonie" auszuarbeiten, die er mit seinem Leben im Rahmen der Evangelisierungsmission, zu der Gott ihn eingeladen hat, interpretiert hat. Auch hier ehrt er seine Rolle als pontifex ("Brückenbauer"), denn er hat die beiden bisweilen gegensätzlichen Ufer des Glaubens und der Kultur zusammengeführt und darüber hinaus das Ideal des christlichen Humanisten verkörpert, indem er dazu ermutigte, alle Kommunikationsmittel sowie die verschiedenen kulturellen und künstlerischen Ausdrucksformen in den Dienst des Evangeliums zu stellen.
Ein wichtiger Teil dieser Bemühungen bestand darin, den Weg des Transzendenten wiederzuentdecken, die Spuren oder Stigmata Gottes, die im menschlichen Herzen vorhanden sind. Darauf bezog er sich auch in der Gedichtsammlung, die er in seinem letzten Lebensabschnitt schrieb (Römisches Triptychon), in dem er schreibt: "Yo llevo tu nombre en mí, / este nombre es signo de la Alianza / que contrajo contigo el Verbo eterno antes de la creación del mundo (…) / ¿Quién es Él? El Indecible./ Ser por Él mismo. / Único. Creador del todo. / A la vez, la Comunión de las Personas. / En esta Comunión hay un mutuo regalo de la plenitud de la verdad, del bien y de la belleza"
In dem Brief, den er am Ende seines Lebens an Professor Giovanni Reale schrieb, dankte Johannes Paul II. der göttlichen Vorsehung dafür, dass sie ihn fähig gemacht hatte, ein solches "kulturelles und spirituelles Unternehmen" - ein Lebensprojekt - zu verwirklichen, in dessen Mittelpunkt immer "der Mensch als Person (...), Abbild des substanziellen Wesens, (...) Gegenstand unablässiger philosophischer und theologischer Analyse" steht. Unserer Meinung nach kann man sagen, dass er dieses Ziel mehr als erreicht hat. Es ist nicht umsonst, wie Rino Fisichella bekräftigt, dass "jeder Nachfolger Petri zur rechten Zeit berufen wird und mit seiner Persönlichkeit den Bedürfnissen entspricht, die sich auf dem Teppich der Geschichte ergeben".
Sacerdote. Doctor en Comunicación Audiovisual y en Teología Moral. Profesor del Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra.