Anlässlich der 1700 Jahrestag Jahre nach dem Ersten Konzil von Nicäa hat ein internationaler Kongress in Brasilien, der Hauptstadt des Bundesstaates Rio de Janeiro, ein neues Licht auf die historische Rezeption und den theologischen Wert dieses Meilensteins des christlichen Glaubens geworfen und dabei akademische Strenge, pastorale Sensibilität und ökumenische Offenheit miteinander verbunden.
Vom 28. bis 30. Mai 2025 wird das Auditorium Johannes Paul II. an der Metropolitankurie der Universität Rom Schauplatz der Erzdiözese von San Sebastian de Rio de JaneiroFachleute aus verschiedenen Teilen der Welt zum Internationalen Kongress "1700 Jahre Erstes Konzil von Nizäa" ein. Die Veranstaltung beschränkte sich nicht nur auf eine Gedenkfeier, sondern wurde zu einem Ort der historiographischen Erneuerung und theologischen Aktualisierung, an dem Spitzenforschung, ökumenischer Dialog und pastorale Reflexion zusammengeführt wurden. Zweifellos bot die Veranstaltung die Gelegenheit, Nizäa mit einem neuen Blick neu zu entdecken.
Unter der wissenschaftlichen Leitung des Forschers João Carlos Nara Jr. und mit finanzieller Unterstützung der Carlos Chagas Filho-Stiftung für Forschungsförderung des Bundesstaates Rio de Janeiro (FAPERJ) stand die Veranstaltung, die von der Fakultät Mar Atlântico organisiert wurde, Studenten, Forschern, Professoren, Mitgliedern religiöser Gemeinschaften und allen Interessierten offen, die ihr Verständnis für die Themen im Zusammenhang mit dem Konzil und seinem historischen, theologischen, philosophischen und kulturellen Einfluss vertiefen wollten.
Auf dem internationalen Kongress sprachen international bekannte Redner wie Monsignore Antônio Luiz Catelan Ferreira, Weihbischof von Rio de Janeiro und Mitglied der Internationalen Theologischen Kommission, und Bruder Serge-Thomas Bonino OP, Präsident der Päpstlichen Akademie des Heiligen Thomas von Aquin, über die Göttlichkeit Christi im Johannesevangelium.
Für João Carlos Nara Jr. hat das Konzil von Nicäa eine zutiefst zeitgenössische Bedeutung, und der Kongress versuchte, einige notwendige Überlegungen zu beleuchten: "Das erste ökumenische Konzil der Geschichte spielte eine grundlegende Rolle bei der Gestaltung der Identität und der Konfiguration der christlichen Welt. Sein Einfluss erstreckte sich auf das theologische und philosophische Denken ebenso wie auf Kunst, Politik, Recht und Kultur in Ost und West. Um unsere heutige Welt voll und ganz zu verstehen, müssen wir uns auf unsere historischen Wurzeln besinnen".
Eine dreigliedrige Struktur und interdisziplinäre Perspektiven
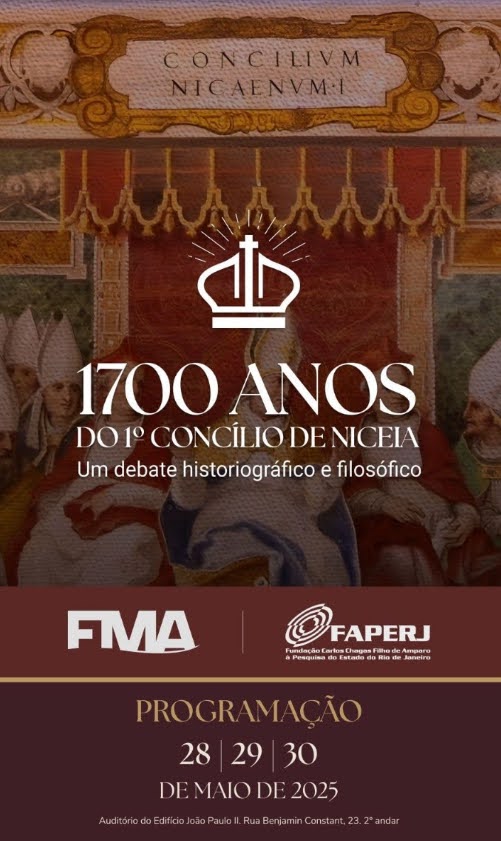
Die Konferenz war dreigeteilt: Am ersten Tag wurden die historischen Auswirkungen vom Römischen Reich bis zur Reformation untersucht; der zweite Tag befasste sich mit der Rezeption des Konzils aus östlicher und westlicher ökumenischer Sicht; und der dritte Tag untersuchte die philosophischen und theologischen Dimensionen, die dem Konzept der Konsubstantialität zugrunde liegen.
Dieser interdisziplinäre und innovative Ansatz führte zu neuen Perspektiven, zur Integration dokumentarischer, ikonographischer und archäologischer Quellen und zur Offenheit für den Dialog.
überkonfessionell, was die Veranstaltung zu einem echten Geschenk für die heutige Kirche macht.
Nizäa mit neuen Augen wiederentdecken
Die Vorträge zeigten, wie sehr die Geschichte von Nizäa noch fruchtbare Felder zu erforschen hat. In seinem Vortrag präsentierte João Carlos Nara Jr. die Vorwegnahme des nizänischen Glaubensbekenntnisses in einer Mariophanie aus dem dritten Jahrhundert, die vom heiligen Gregor Thaumaturgus gelebt wurde und die aktive Rolle der Jungfrau Maria bei der Bewahrung der christlichen Orthodoxie hervorhob.
André Rodrigues (PUC-Rio) bot eine neue Interpretation des griechischen Begriffs "homoousios" ("wesenhaft") und wies darauf hin, dass seine zentrale Bedeutung eher aus den nachnizänischen Kontroversen stammt. Seiner Analyse zufolge war die Verkündigung "gezeugt, nicht geschaffen" der eigentliche theologische Schlüssel in der Antwort auf den Arianismus.
Der runde Tisch zum östlichen Christentum mit Beiträgen von Alin Suciu (Akademie Göttingen) und Julio Cesar Chaves (Theologische Fakultät der Erzdiözese Brasilia) rettete Stimmen, die in der westlichen Geschichtsschreibung oft marginalisiert werden. Die Gestalt des heiligen Athanasius von Alexandrien wurde in seinem nachkonziliaren pastoralen Werk als Schlüssel zum Verständnis der konkreten Umsetzung der konziliaren Beschlüsse vorgestellt.
Akademische Innovation und inkarnatorischer Glaube
Ein Höhepunkt war der Vortrag von Professor Manuel Rolph de Viveiros Cabeceiras (Fluminense Federal University), der zeigte, wie die Integration von archäologischen, numismatischen und textlichen Quellen ein tieferes Verständnis des nizänischen Kontextes ermöglicht.
Professor João Vicente Vidal untersuchte in seinem Vortrag "Das nizänische Symbol in der Musik des kolonialen Brasiliens", wie das nizänische Glaubensbekenntnis im 18. Jahrhundert vertont wurde, und zwar anhand von Partituren, die in der Curt-Lange-Sammlung des Museu da Inconfidência Mineira (Museum für Unwissenheit) gefunden wurden. Seine Darbietung zeigte, wie der Glaube in Klängen, Praktiken und Gefühlen verkörpert werden kann.
Ökumenische Dimension und gegenseitiges Zuhören
Der Kongress zeichnete sich auch durch seine ökumenische Offenheit aus: Vertreter anderer christlicher Traditionen, wie der lutherische Pfarrer Païvi Vahäkängas (Finnland) und der presbyterianische Pfarrer Isaías Lobão (Brasilien), berichteten, wie ihre jeweiligen Konfessionen das nizänische Erbe aufgenommen und angepasst haben.
Box schlug vor: "Der Austausch, eine echte Übung im gegenseitigen Zuhören, bestätigt, dass das Nizänische Glaubensbekenntnis das gemeinsame Erbe aller Christen ist, auch wenn die Rezeption seiner Kanones je nach kirchlichem Kontext unterschiedlich ist".
Akademische Implikationen und der weitere Weg
Antônio Catelan Ferreira über das Dokument "Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter", das kürzlich von der Theologischen Kommission veröffentlicht wurde.
International, stellte relevante Verbindungen zwischen historischer Forschung, theologischer Reflexion und dem heutigen Leben der Kirche her. Er zeigte, wie das Studium des Konzils von Nizäa für liturgische, ökumenische und formative Fragen relevant bleibt.
Der runde Tisch über die Auswirkungen von Nizäa auf das christliche Denken mit Beiträgen von Renato José de Moraes (Faculdade Mar Atlântico) und Pater Wagner dos Santos (PUC-Rio) unterstrich die Fruchtbarkeit der Begegnung zwischen Philosophie und Theologie rund um das Geheimnis Christi.
Die hier vorgestellten Untersuchungen eröffnen vielversprechende Wege für künftige Studien. Die Notwendigkeit einer Neubewertung von Konzepten, die als zentral angesehen werden - wie etwa die Konsubstantialität - legt nahe, dass andere Aspekte des Rates von neuen methodischen Ansätzen profitieren könnten. Der wissenschaftliche Ausschuss der Veranstaltung arbeitet bereits an einem Buch, in dem die wichtigsten wissenschaftlichen Beiträge zusammengefasst werden sollen.
Seelsorgerische Dimension und empfangener Segen
Große Unterstützung erhielten die Kongressteilnehmer von Kardinal Orani João Tempesta, dem Erzbischof von Rio de Janeiro, und von Papst Leo XIV, dem neu gewählten Papst.
In seinem Schreiben, das bei der Eröffnung der Veranstaltung verlesen wurde, beglückwünschte Kardinal Orani die Maratlantische Fakultät und die Organisatoren des Kongresses und betonte: "Das Konzil von Nizäa war mehr als eine Lehrdebatte, es war eine pastorale und theologische Antwort auf die Herausforderungen der Einheit im Glauben.
Er fügte hinzu: "Die Feier des 1700-jährigen Jubiläums von Nizäa bedeutet, anzuerkennen, dass der christliche Glaube im Konkreten verwurzelt ist und sich im Dialog mit den menschlichen Kontexten entwickelt. "Ich spreche allen meinen Segen aus und wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Arbeiten und Studien des Kongresses.
Diese Segnungen und Botschaften waren ein deutliches Zeichen dafür, dass die Kirche die Früchte der aktuellen theologischen Forschung begleitet.
Die Konferenz bot auch wertvolle Interpretationshilfen für christliche Pädagogen, die ihnen dabei halfen, lehrmäßige Entwicklungen nuancierter und fundierter darzustellen. Für Kirchenhistoriker bot sie ein kontextbezogenes methodisches Modell, das anachronistische Interpretationen vermeidet.
Es wurde bekräftigt, dass das Konzil von Nicäa nicht als eine isolierte Episode im Jahr 325 zu verstehen ist, sondern als ein dynamischer Prozess der Rezeption und Interpretation, der sich über die Jahrhunderte hinweg weiterentwickelt. Diese diachrone Perspektive zeigt die Vitalität der christlichen Tradition und ihre Fähigkeit zur kulturellen Anpassung ohne Identitätsverlust.
Eine Erinnerung, die die Zukunft erhellt
Der internationale Kongress hat gezeigt, dass die 1700 Jahre des Konzils von Nizäa nicht einfach ein historisches Ereignis sind, sondern eine Gelegenheit, Glaube, Vernunft und Tradition mit den Herausforderungen der Gegenwart zu verbinden. Zweifellos markierte die Veranstaltung den Beginn neuer Forschungen und Veröffentlichungen über das nizänische Erbe.
Nizäa bleibt ein Punkt der Konvergenz unter den Christen, eine Säule des Glaubens an die Göttlichkeit Christi und eine lebendige Referenz für den theologischen Dialog. In Zeiten der Zersplitterung erinnert uns diese Gedenkfeier daran, dass die christliche Wahrheit sowohl einzigartig als auch gemeinsam ist. Das Konzil von Nizäa ist nicht nur Vergangenheit, sondern ein lebendiges Erbe, das sich in einem ständigen Prozess der Rezeption und Aktualisierung befindet.








