Was Gott den Menschen zu ihrem Heil schenkt, sind keine Gaben, sondern Geschenke. Gewiss, die Mittel zur Errettung nützlich sind um sie zu erreichen. Aber über die Nützlichkeit für das, was wir erreichen können, hinaus ist die Tatsache, dass vorhanden sind zu Gott. Vielmehr sind sie nicht nur eine Erinnerung, sondern Gott ist derjenige, der vorhanden ist in seinen Gaben, die die Sakramente und das Gebet sind. Aus dieser Ehrfurcht und der Erwartung einer erstaunlichen Begegnung heraus muss der Christ den Empfang der Sakramente betrachten: immer gleich und immer anders. In diesem Artikel werden wir uns auf die Beichte die eine neue Sichtweise der Dinge vorschlagen. Wenn wir eine Beziehung zu Gegenständen oder sogar zu Tieren haben, können wir alles vorhersehen, was passieren wird und Bewältigung der Situation. Wenn es sich jedoch um eine persönliche Begegnung handelt, ist nicht alles vorhersehbar, und wir müssen offen sein, dem anderen zuzuhören und unsere Interaktionen anzupassen. Wenn den anderen Gott ist, ist die Offenheit für Überraschungen eine unumgängliche Voraussetzung. Wir können nicht mit der Erwartung zu den Sakramenten gehen, dass das geschieht, was wir bereits wussten, auch wenn wir wissen, dass das Bekenntnis der Sünden zur Vergebung führen wird. Jede Begegnung mit dem Schöpfer ist unaussprechlich, einzigartig und unwiederholbar, auch wenn der Pönitent, die Sünden und der Beichtvater dieselben sind.
Wiederbelebung des Bekenntnisses
Johannes Paul II. förderte die Wiederbelebung der Beichte durch die Einberufung einer Synode und die Veröffentlichung des apostolischen Schreibens Reconciliatio et paenitentiaEr warnte vor dem Verlust des Sündenbewusstseins und bekräftigte die Lehre vom Sakrament der Buße. In der Folge wurden zahlreiche pastorale Initiativen umgesetzt, wie die Verlängerung der Beichtzeiten, die Wiederbelebung des Beichtstuhls und die Katechese über Sünde und Vergebung.
Heute ist die Beichtkultur zwar dort wiederbelebt worden, wo den Vorschlägen des polnischen Papstes gefolgt wurde, aber die digitale Revolution und die sich beschleunigenden Veränderungen in der Gesellschaft stellen neue Herausforderungen und Chancen für ein tieferes Verständnis des Sakraments dar. Wir leben in einem ständigen Wandel, der sich rasend schnell vollzieht. In diesem Sinne können wir sagen, dass wir zu einer Gesellschaft gehören, die in einem beschleunigten Tempo lebt, weil sie sich an Veränderungen anpassen muss, ohne Zeit zu haben, sie zu verarbeiten.
Die postmoderne Krise
Der Druck des Sozialen und des Neuen hat ein Thema hervorgebracht überstimuliert und infolgedessen ein affektiver Analphabetismus aufgrund ihrer fehlenden Innerlichkeit. Auch wenn das Wohlstandsniveau und die Qualität der Dienstleistungen gestiegen sind, ist es unbestreitbar, dass es eine anthropologische Krise gegeben hat, die sich in ängstlichen Persönlichkeiten, tiefen emotionalen Wunden, Einsamkeit, psychischen Pathologien und leider auch in einer in anderen historischen Epochen unbekannten Selbstmordrate bei jungen Menschen manifestiert.
Die Kultur des Erfolgs ist zu einem gestörten Verhältnis zur Arbeit und zu einem ständigen Wettbewerb mit Gleichaltrigen verkommen. Wir finden ein Thema Emotivist und entwurzelt.
Auswirkungen auf die Beichte
Angesichts dieser kulturellen Situation ist es notwendig, die tröstende Wirkung des Sakraments der Beichte zu betonen, damit es nicht zu einem Ort der persönlichen Frustration wird. Wenn wir weiterhin die Notwendigkeit betonen, bei der Anklage von Fehlern präzise und konkret zu sein, kann dies dazu führen, dass der perfektionistische Voluntarismus, der die Kinder unserer Zeit kennzeichnet, vertieft wird.
Goodwill
Einerseits ist es notwendig, die Bedeutung der Sünde weiter zu vertiefen, wie Johannes Paul II. warnte. Heute neigen wir dazu, die Freiheit zu betrachten, ohne zu unterscheiden zwischen der natürlich und spontan. Wir denken, dass alles, was aus unserem Inneren kommt, ein natürlich und wir halten uns nicht für schuldig an schlechten Gedanken oder schlechten Absichten. Wenn wir schlechte Handlungen begehen, versuchen wir Schuldige dem wir die Ursache für unser Fehlverhalten zuschreiben, oder wir denken, dass jeder andere unter den gegebenen Umständen genauso gehandelt hätte. die uns ungerecht zu sein. Dies wird umgangssprachlich als die Goodwill. Wenn ich zum Beispiel aggressiv und unverhältnismäßig auf einen Autofahrer reagiere, der mich auf der Straße übermäßig kreuzt, werde ich denken, dass er für meine unfaire Reaktion verantwortlich ist oder dass jeder andere das Gleiche getan hätte.
Utilitarismus
Darüber hinaus haben die Konsumkultur und die utilitaristische Sprache den Bereich der Wirtschaft und des Marktes überschritten und Bereiche wie die Bildung und die eigene Wahrnehmung kolonisiert. Byung Chul-Han zum Beispiel beschreibt den postmodernen Menschen als Leistungsfach. Jemand, der unter sozialem Druck nach Effektivität und Effizienz steht, der ihn dazu bringt, vor sich selbst zu leben, entsprechend den sozialen Anforderungen an hervorragende Ergebnisse, zum Nachteil des persönlichen Wohlbefindens und der Pflege von Beziehungen.
Dieses Selbstwertgefühl kann dazu führen, dass das Sakrament der Beichte als ein Ort verstanden wird, an dem man Rechenschaft über unzureichende Leistungen ablegen muss, in der Erwartung, dadurch Motivation und Kraft zu gewinnen, um sich weiterhin um soziales Engagement zu bemühen. Es liegt auf der Hand, dass die Verzerrung, die dieser Sichtweise von wahrgenommenem Wert und persönlicher Berufung zugrunde liegt, Christen hervorbringt, die ängstlich und frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, ihrer christlichen Berufung nicht gerecht zu werden. Dies erklärt, warum Papst Franziskus darauf besteht, dass die Beichte ein Ort der Barmherzigkeit und nicht ein Gerüst der psychologischen und spirituellen Folter sein sollte.
Konsumverhalten
Darüber hinaus erstreckt sich der konsumorientierte Lebensstil auch auf die Beziehung zu den spirituellen Mitteln und führt zu einer Instrumentalisierung der Sakramente, auf die die Menschen zurückgreifen, um ein Problem zu lösen o Einhaltung einer Vorschrift. Der Besuch der Sonntagsmesse ist ein Austauschverhältnis, das die Dimension der Begegnung in den Hintergrund drängt: Das Gebot wird erfüllt, um das ewige Leben zu erlangen, aber es gibt kaum eine Teilnahme an der Feier des Geheimnisses Gottes, am Hören auf sein Wort usw. Selbst der Gedanke, zur Messe zu gehen, "um zu beichten und die Kommunion zu empfangen", wird als selbstverständlich angesehen.
So etwas wie die Ausnutzung eines zwei für einenauch wenn die Beichte übereilt ist, oder während der Lesung des Evangeliums oder sogar bei der Konsekration. Dieses Verhalten offenbart, dass neben der unbestreitbar guten Absicht des Pönitenten ein tiefgreifender Mangel an liturgischem Sinn und Verständnis für das Sakrament besteht. Man wendet sich an um etwas zu bekommen anstelle von jemanden zu treffen.
Narzissmus
Eine weitere typische Verzerrung der Sakramente unserer Zeit ist die narzisstische Einstellung zur Sünde. Die Leistungsfach betrachtet die Sünde als einen Fehler, den er hätte vermeiden müssen, und erkennt an, dass er ihn nicht begangen hat. Wenn er sich diesen Fehler vorwirft, kann es sein, dass er mehr auf seine Unvollkommenheit als auf das Vergehen gegen Gott achtet. Es kann sogar vorkommen, dass er um Vergebung für Fehler bittet, die kein Vergehen darstellen, und Sünden außer Acht lässt, die aus tiefem Schmerz entstanden sind, weil sie in seinem Verhalten nicht offensichtlich sind.
Der Narzissmus führt uns zu einer Selbstreferenzialität, vor der auch Papst Franziskus warnt, in der wir nicht mehr zwischen dem Schuldgefühledie ein psychologischer und persönlicher Zustand des Menschen ist, der Sündenbewusstsein die, ausgehend von den Schuldgefühlen, diese auf die persönliche Beziehung zu Gott bezieht und von der psychologischen Ebene zur theologischen Dimension der Beziehung zum Schöpfer übergeht. Ein Merkmal des Narzissmus ist der Anschein, von sich selbst Vergebung zu erbitten. dass ich nicht so war, wie ich hätte sein sollen.
Atrophien und Hypertrophien
Alle diese Verzerrungen im Zusammenhang mit dem Sakrament der Beichte offenbaren Mängel und Auswüchse des Herzens der Leistungsfach der sein christliches Leben leben will.
Der erste große Fehler ist die Vorstellung von Gott selbst. Der Christ neigt dazu, sich als jemand zu sehen, der muss der Aufgabe gewachsen sein und schreibt, wie die Calvinisten, dem Schöpfer eine Erfolgserwartung im Berufs-, Familien-, Beziehungs- und Evangelisationsleben zu, anhand derer er sein Wachstum in der persönlichen Heiligkeit beurteilen wird. Diese falsche Sichtweise von Gott endet in einem Zustand geistlicher Apathie aus Hoffnungslosigkeit oder in einer kleinmütigen perfektionistischen Starre, die seine Kämpfe auf das reduziert, was er kontrollieren kann.
Der zweite Fehler ist die Vorstellung von Gottes Gnade als einer äußeren Hilfe für Gutes tun was man aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Eine Art geistiges Vitamin, mit dem man höhere Stufen der Heiligkeit erreichen kann. Das führt zu einer tiefen Frustration, wenn man feststellt, dass die Häufigkeit der Sakramente die Ergebnisse nicht verbessert. Er ist dann verzweifelt und denkt, sein Problem sei der fehlende Glaube, weil er nicht intensiv genug auf sie vertraut. Denn natürlich ist die Gnade kein Ersatz für die Freiheit, und sie ist auch nicht das, was der Leistungsfach Am Ende gibt sie nach und versucht, ihren religiösen Sinn und ihre Hoffnungslosigkeit mit inkohärenten Verhaltensweisen zu vereinen, die die Krise noch verschärfen. Letztendlich läuft es auf ein Christentum hinaus, das Formular die einen Agnostizismus Hintergrund.
Christliche Ängste und Zerbrechlichkeit
Die Auswüchse der Leistungsfach in seiner Beziehung zu Gott lässt sich in einem Punkt zusammenfassen: Angst. Deshalb geht er in ängstlicher, oberflächlicher, wiederholender und instrumenteller Weise zur Beichte. Er hat Angst vor seinen Sünden und will sie wegwaschen wie jemand, der einen Fleck wegwäscht, der wieder auftaucht. Der Ritus der Beichte wird entbehrlich, und er wiederholt die Worte wie eine Zauberformel, um das von ihm erwartete Ergebnis zu erzielen. Er versucht auch nicht, seine Seele zu öffnen, um sie Christus zu zeigen, sondern spricht nur aus, was ihn bedrückt, in der Hoffnung, das erwartete Ergebnis zu erhalten. die magischen Worte der Freispruch, um ganz neu anfangen.
Gott ist diese Zerbrechlichkeit nicht gleichgültig. Seine Liebe zu seinen Kindern macht ihn wachsam und ihnen zugeneigt. So wie die Hilflosigkeit und Ohnmacht eines kleinen Kindes in seinen Eltern die ganze Zärtlichkeit weckt, die sie zu ständiger und bedingungsloser Fürsorge bewegt. Die Frage Gottes an den Menschen lautet nicht was Sie getan haben sondern Was ist los mit dir?. Diese Unterscheidung ist für das Verständnis der Beichte von entscheidender Bedeutung, denn wir wissen durch die Symptome, die sich in dem manifestieren, was wir getan haben, was mit uns los ist. Aber die Beichte ist keine Rechenschaft darüber, was wir falsch gemacht haben, sondern die Suche nach dem was mit mir los ist ab dem was ich getan habe.
Von der Sünde zur Verletzung
Mit anderen Worten, es ist notwendig, die Sünde von der Wunde zu unterscheiden (ohne sie zu trennen), um zu verstehen, dass Gott in der Beichte die Sünden vergibt, die wir bekennen, aber die Wunden seiner Kinder küsst und bei ihnen bleibt. Die Sünden werden vergeben, aber die Wunden bleiben und Gott in ihnen. Daher besteht die Erwartung an die Beichte nicht darin, dass wir sie eines Tages vermeiden können, sondern darin, die Sünde in einen Ort der liebevollen Begegnung zu verwandeln. So wie die Krankheit eines Kindes der Grund dafür ist, dass Eltern eine zärtlichere, tiefere und bedingungslosere Bindung zu ihrem Kind aufbauen, so liebt Gott uns als Vater, der eine engere Bindung zu seinen bedürftigsten Kindern hat.
Wir dürfen die Sünde nicht als ein Vergehen verstehen, das wir Gott direkt zufügen können. Es gibt eine Kluft zwischen seinem Wesen und dem unseren. So groß und intensiv unsere Sünden auch sein mögen, sie reichen nicht bis zu Schaden Das Wesen Gottes. Der Grund, warum es eine Beleidigung gibt, ist, dass die Liebe immer eine Antwort erwartet. Es ist nicht wahr, dass zu lieben bedeutet, nichts zurück zu geben. Weil sie eine Beziehung ist, hat sie immer die Hoffnung auf Gegenseitigkeit. Es ist wahr, dass die wahre Liebe gibt, auch wenn sie keine Gegenleistung erhält, aber das bedeutet nicht, dass sie keine Gegenleistung erwartet. Genau darin liegt die Verwundbarkeit des Liebenden: Er setzt sich freiwillig der Möglichkeit aus, zurückgewiesen zu werden oder keine Erwiderung zu erhalten. Es ist dieselbe Logik des Geschenks: Derjenige, der das Geschenk macht, erwartet, dass der andere es zumindest mag oder sich darüber freut. Gleichgültigkeit oder Ablehnung des Geschenks verletzen den Geber. Die Sünde als Vergehen an Gott besteht darin, die Liebe, die er uns anbietet, abzulehnen oder nicht anzunehmen. Indem er Geschenke macht, verschenkt Gott sich selbst, wie wir zu Beginn dieses Artikels gesagt haben. Darin liegt seine Verwundbarkeit.
Die richtige Einstellung
Die richtige Art und Weise, zur Beichte zu gehen, ist daher die eines Menschen, der im Begriff ist, ein kostbares Geschenk von jemandem zu erhalten, der ihn sehr liebt. Das motiviert zum Bekenntnis der Sünden - nach einer guten Gewissenserforschung, mit der entsprechenden Unterscheidung nach Anzahl und Art der Todsünden usw. - und zur Öffnung des Herzens, um die Liebe anzunehmen, die Gott anbietet. Dies ist der Weg, um die Vision zu überwinden legalistisch der bloßen Verantwortlichkeit und der oben genannten Atrophien und Hypertrophien.
Die Goodwill hat zu einer für unsere Zeit typischen Verwechslung geführt, die darin besteht, Entschuldigung mit Bitte um Vergebung zu verwechseln. Diese Ausdrücke werden als Synonyme angesehen, obwohl sie in Wirklichkeit entgegengesetzte Bedeutungen haben. Dis-blame ist es, einen Schaden, der jemandem zugefügt wurde, anzuerkennen, aber darum zu bitten, dass er ihm nicht angelastet wird, weil er aus Gründen entstanden ist, auf die der Spender keinen Einfluss hat. Man entschuldigt sich, wenn man wegen eines Staus oder einer Störung der Verkehrsmittel zu spät zu einem Termin kommt usw. Derjenige, der sich entschuldigt, bittet um etwas, worauf er ein Anrecht hat: Wenn ihn keine Schuld trifft, kann sie ihm nicht angelastet werden. Es ist richtig, dass sie gewährt wird.
Im Gegenteil, die Bitte um Vergebung entspringt der Anerkennung eines Fehlers, der dem Handelnden zuzurechnen ist. Derjenige, der um Vergebung bittet, bittet um etwas, das ihm nicht zusteht, weil er aus Nachlässigkeit oder Bosheit ungerecht gehandelt hat. Er begibt sich also in eine Situation der Unterlegenheit und appelliert an die Größe des Herzens des Beleidigten. Er kann sie ihm nur gewähren, wenn er ihn liebt. über ihren Fehlern stehen und akzeptiert großzügig den Erlass der Schuld und die Aufhebung des Grolls und des Wunsches nach Rache, auch wenn das Vergehen zu einem nicht wiedergutzumachenden Schaden geführt haben mag. Wer um Vergebung bittet, demütigt sich, weil er nicht etwas einfordert, auf das er ein Anrecht hat, sondern ein Gut, um das er bittet.
Das Drama des Weltverbesserertums
Die buenista versteht, dass die Ursachen für seine schlechten Handlungen außerhalb seiner selbst liegen, weil er, wie wir bereits erklärt haben, die Ursache mit dem Auslöser verwechselt. Dies führt dazu, dass er die Bitte um Vergebung als eine Position unerträglicher Schwäche betrachtet und die Bitte um Entschuldigung mit Argumenten füllen muss, so dass er nicht das Vergehen betont, sondern die gute Absicht, die ihn entschuldigt. Sein Seelenfrieden kommt eher von seinem eigenen Vorsatz, nicht wieder straffällig zu werden, als von der Liebe desjenigen, der ihm vergibt. Deshalb manifestiert und fördert die Beichte seinen unreifen Eigensinn und nicht die wirkliche Hingabe an die Barmherzigkeit Gottes.
Vor Gott niederzuknien, seine Wunden zu zeigen und sich selbst für begangene Sünden anzuklagen, ist zutiefst tröstlich, weil man immer Gottes Herz findet, das bereit ist zu vergeben und zu verwandeln. Gott liebt uns nicht für das, was wir gut machen, sondern weil wir seine Kinder sind und uns lieben lassen. In unserem Bemühen, das Gute zu tun, erkennt er unseren guten Willen und ist von ihm bewegt, aber er braucht ihn nicht, um uns zu lieben. Ihm ist es wichtiger, dass wir uns so lieben lassen, wie wir sind, ohne uns ein Bild von uns zu machen auf der Grundlage dessen, was wir sein sollen, sollten wir.
Wirklich gut sein
Wer sich selbst hinreichend gut kennt und reif genug ist, ist sich seiner Unsicherheit in Bezug auf das Verlangen nach Erfüllung bewusst, das durch die Ansteckung mit der Sünde verschlimmert wird, die sich in der Abweichung der Absichten und der Beweggründe äußert, die ihn bewegen, selbst wenn er gut handelt. Daher ist er nicht überrascht, wenn er Dinge tut offenbar gut sind, die ihn aber nicht zu einem besseren, sondern zu einem schlechteren Menschen machen, weil sie mit schlechten Absichten oder aus ungerechten Motiven heraus geschehen. Diese Unterscheidung zwischen etwas richtig machen y gut sein ist ebenfalls entscheidend für das Verständnis des Bekenntnisses.
Jesus macht den Pharisäern im Evangelium vor allem deshalb Vorwürfe, weil sie zwar gute Taten tun, aber ihr Herz nicht gut ist. Die Motive sind Eitelkeit, Machtausübung oder Verachtung für andere, selbst bei der Erfüllung ihrer Pflichten oder bei der Ausübung des Gottesdienstes. Bei der Betrachtung ihrer guten Taten fühlen sie sich des Verdienstes und des Wohlwollens Gottes würdig. Jesus aber richtet die schlimmsten Beschimpfungen und Beleidigungen gegen sie: Schlangenvolk, weiße Gräber, wehe euch, Pharisäer, Heuchler usw.
Zweifellos sollte der Christ danach streben, Gutes zu tun und sich um die Welt und um andere zu kümmern. Er sollte sich jedoch nicht darauf verlassen, dass dies seine Heiligkeit oder Nähe zu Gott garantiert. Er muss sich der Abweichung seiner Motivationen und Absichten bewusst sein, wenn er schlechte, gleichgültige oder gute Dinge tut, und er muss erkennen, dass diese Verzerrung das persönliche Gute, das er mit seinem Handeln beabsichtigt, verdirbt. Seine Zerbrechlichkeit und die Ansteckung der Wunde bedürfen der Begleitung und Umwandlung, die nur Gott bewirken kann.
Schönheit nach dem Schmerz
Gerade in der Betrachtung seines Mangels an innerer Schönheit wird er Christus in seiner Passion als -der schönste aller Männer (Ps. 45, 3), deren Schönheit vom Kummer überschattet wird (Jes. 53, 2). Jesus verkörpert den Perlenhändler, der, wenn er eine Perle von großem Wert findet, alles, was er hat, verkauft und diese Perle kauft (Mt 13,45-47). Seine alles verkaufen, was er hatte ist die Erniedrigung des Wortes Gottes zum Menschen und die Erniedrigung zum Tod (Phil 2,5), und die Perle von großem Wert ist das Herz des Sünders.
Der Pönitent, der mit dieser Vision zur Beichte kommt, will sich trotz der Sünden, die die Perle seines Herzens trüben, von Gott, dem Menschen, wertgeschätzt fühlen. Er erfreut sich an der unnahbaren Barmherzigkeit und Verzweiflung des Schöpfers selbst. Er lässt es zu, dass die Liebe Gottes ihn als Mensch betrachtet. gut trotz all des Bösen, das er getan hat. Aus dieser dankbaren Verwunderung heraus entsteht ein natürliches Bemühen, die Dinge gut zu machen, aber er wird das Ergebnis seiner Bemühungen nicht als seinen Wert vor Gott ansehen.
Das wahre Ich
Perfektionismus führt dazu, dass wir uns nach einem idealisierten Bild von uns selbst beurteilen, was zu Unzufriedenheit führt. Während es natürlich ist, nach Fülle zu streben, bedeutet Reife, die Realität authentisch zu akzeptieren, so wie Gott uns sieht, der keine Perfektion oder Effizienz verlangt. Wahre Reife besteht nicht darin, einen unerreichbaren Standard vorzugeben, sondern darin, uns ehrlich zu zeigen und zu verstehen, dass es kein Vergehen ist, wenn wir uns irren und unsere Ziele nicht erreichen.
Das Thema der Beichte sind nicht so sehr die Fehler, sondern der Bruch der Beziehungen zu Gott oder zu den anderen. Das heißt, die Unordnung der Liebe. Das irreale Selbstbild macht es dem Pönitenten unmöglich, Gott zu begegnen, weil er selbst bei dieser Begegnung abwesend ist. Nicht er erscheint, sondern ein falsches Bild von sich selbst. Es gibt keine Begegnung, sondern nur eine Erscheinung. Deshalb gibt es auch keinen Trost, sondern Qualen.
Das Gewissen prüfen
Fragen, die als Gewissenserforschung angeboten werden, können dem Lahmen als Krücken dienen. Sie sind eine gültige Unterstützung für jemanden, der keine Fähigkeiten oder Gewohnheiten im Umgang mit Gott hat, aber sie sind nutzlos oder sogar kontraproduktiv für jemanden, der gesund ist. Wenn man Krücken benutzt, obwohl man gut gehen kann, verlangsamt sich der Gang und verhindert eine harmonische Bewegung des Körpers.
Wer sein Gewissen anhand einer Liste von Sünden prüft, übersieht die Beweggründe und Absichten, die zu scheinbar guten Handlungen führten, aber sein Herz beschmutzten und persönliche Bindungen zerrissen.
Vom Schuldgefühl zum Bewusstsein der Sünde
Das Schuldgefühl muss untersucht werden, und darum geht es bei der Unterscheidung, und zwar auf der Grundlage wichtiger persönlicher Beziehungen. Das heißt, vom Schuldgefühl zum Bewusstsein der Sünde überzugehen, wegen des Vergehens an Gott oder an anderen, das dieses Schuldgefühl offenbaren kann (oder auch nicht).
Der postmoderne Christ ist von emotionalen Wunden und inneren Spannungen betroffen, er ist Arbeits- und Lebensrhythmen ausgesetzt, die seine Anpassungsfähigkeit übersteigen, und er ist in eine Kultur des Wettbewerbs mit seinesgleichen eingetaucht. Er läuft Gefahr, seine Beziehung zu Gott auf eine individualistische und narzisstische Weise zu interpretieren und sich infolgedessen mit einer Mentalität und Erwartungshaltung an die Mittel des Heils zu wenden, die nicht der Barmherzigkeit Gottes entsprechen.
Seelsorgerische Betreuung einer heilenden Konfession
Es ist dringend notwendig, die Evangelisierung neu zu überdenken, ohne die Integrität des katholischen Dogmas und der Lehre zu untergraben, sondern vielmehr durch die Klärung von Aspekten des Geheimnisses der Beziehung Gottes zu den Menschen, die der Liebe Gottes zu den Menschen gerecht werden: "...die Liebe der Kirche zu den Menschen ist nicht eine Sache der Vergangenheit, sondern der Zukunft".Wir haben Gottes Liebe zu uns erkannt und daran geglaubt". (1 Joh 4,16). Diese Entwicklung erfordert eine Pastoral, die sich ganz auf Jesus Christus konzentriert, die der Beziehung den Vorrang vor dem Austausch gibt, die den Gläubigen eine tiefe liturgische Bedeutung verleiht und die sich auf eine Anthropologie stützt, in der die sein liegt vor dem seinund die sein vor der machen.. Die Gläubigen sollten nicht versuchen etwas an Gott, sondern an jemand.
Der Ritus als Glanz der Barmherzigkeit
Das Gleiche gilt, wenn ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag macht. Information allein reicht nicht aus. Die Intensität und die Bedeutung des Augenblicks müssen in einer angemessenen Landschaft ausgedrückt werden, indem man sich hinkniet, einen Ring anbietet usw. Diese Handlungen ermöglichen es, die affektive und projektive Vereinigung dieser Menschen intensiv und lebendig zu erleben. Der Ritus der Beichte ist, wie der der Messe, eine schöne Geste der Begegnung zwischen dem Pönitenten und Gott. Die Worte sind den Begegnungen zwischen dem heiligen Petrus und Jesus entnommen, die das Leben des ersten Papstes biographisch geprägt haben. Der kniende Pönitent hört vom Priester, dass sich das Ereignis seiner Vergebung in seinem eigenen Herzen abspielt. Außerdem beruft sich die Lossprechungsformel auf die Dreifaltigkeit, die Jungfrau Maria, die Heiligen usw. und wird im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes erteilt. Derselbe Name, auf den wir getauft wurden. All diese Sätze sind kein Protokoll, das zu befolgen ist, sondern der symbolische Ausdruck des Ereignisses der Begegnung. Es lohnt sich, das Bekenntnis anhand dieser ausdrucksstarken Szenen aus dem Evangelium vorzubereiten und die Formel der Absolution zu meditieren. In diesem Kontext ist das Sündenbekenntnis freudig und tröstlich, denn der Pönitent erfährt die Vergebung der Vergehen und den Kuss auf seine Wunden. Er geht getröstet, getröstet und mit dem Wunsch weg, immer mit seinem Herrn vereint zu leben.
Zerbrechliche Kinder eines verletzlichen Gottes
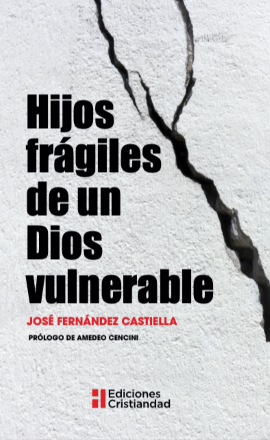
Priester und Doktor der Moraltheologie. Autor von Zerbrechliche Kinder eines verletzlichen Gottes (Christentum, 2025).








