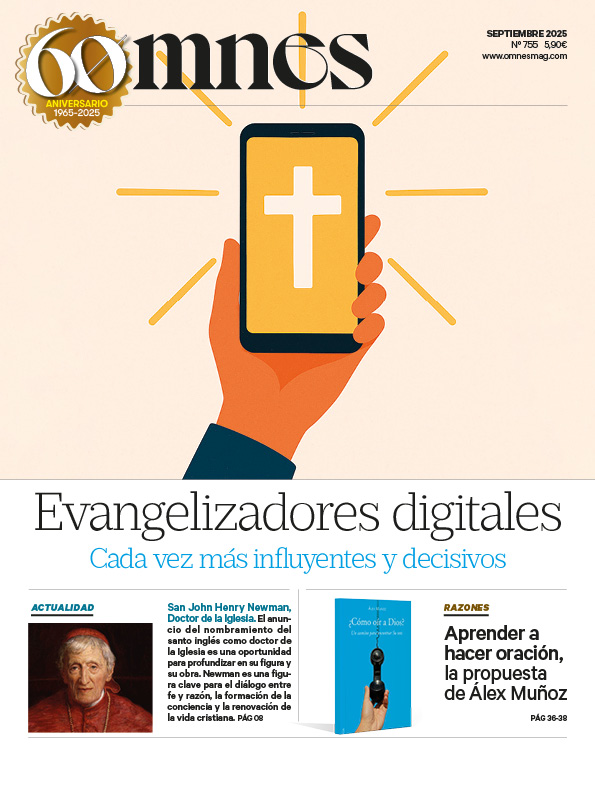In den letzten Jahren hat sich das Interesse an "Der Herr der Ringe" von TolkienZu den jüngsten Veröffentlichungen gehören die Amazon-Prequel-Serie "The Rings of Power", der Actionfilm und Anime "War of the Rohirrim" und das Videospiel "Return to Moria" sowie mehrere Projekte in der Pipeline.
Da die Geschichten von Mittelerde weiterhin ein neues Publikum erreichen, werden die Leser und Zuschauer unweigerlich von den tiefgreifenden religiösen Themen angezogen, die in Tolkiens Werk verwoben sind - ein Einfluss, der auf seine zutiefst katholische Erziehung zurückzuführen ist.
Tolkien selbst war sich jedoch über seine Absichten im Klaren. Obwohl sein Glaube unweigerlich seine Vorstellungskraft prägte, widersetzte er sich der Vorstellung, dass seine Geschichten als direkte Allegorien angesehen werden könnten. "Ich lehne die Allegorie in all ihren Erscheinungsformen ab, und das schon immer, seit ich alt und vorsichtig genug geworden bin, um ihre Präsenz zu erkennen", schrieb er einmal.
Stattdessen bevorzugte Tolkien die Idee der "Anwendbarkeit" und glaubte, dass die Leser ihre eigenen Bedeutungen in seinen Geschichten finden sollten, anstatt von der Hand des Autors geleitet zu werden. Für ihn bot das wahre Geschichtenerzählen Freiheit, nicht Belehrung.
Trotz dieses Haftungsausschlusses haben viele auf die unbestreitbare Präsenz der Symbolik hingewiesen biblisch in Tolkiens "Der Herr der Ringe", insbesondere in den Figuren von Frodo, Gandalf und Aragorn.
Frodo: Der christusähnliche Lastenträger
Die vielleicht offensichtlichste christliche Parallele besteht zwischen Frodo und Christus. Obwohl Christus ohne Sünde war, nahm er die Sünden der Welt auf sich und opferte sich schließlich für die Menschheit. In ähnlicher Weise nimmt Frodo, der selbst unschuldig ist, die Last des Einen Rings auf sich und reist zu dessen Vernichtung auf den Schicksalsberg. Das zunehmende Gewicht des Rings spiegelt den Kampf Christi mit dem Kreuz wider, eine Last, die immer schwerer wird, je näher er dem Kalvarienberg kommt.
Tolkiens Bildsprache ist beeindruckend: Sam entdeckt das erdrückende Gewicht des Rings, nachdem er ihn kurzzeitig selbst getragen hat, mit gesenktem Kopf, "als ob ein großer Stein in ihm aufgespießt worden wäre" ("Die zwei Türme", S. 434). In ähnlicher Weise bricht Christus unter der Last des Kreuzes zusammen und braucht die Hilfe von Simon von Cyrene (Lukas 23,26). In einem subtilen sprachlichen Echo wird Frodo auch von Sam geholfen, dessen Name eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit "Simon" aufweist.
Die Versuchung stellt eine weitere Verbindung zwischen Frodos Reise und der von Christus her. So wie Christus in der Wüste vom Satan versucht wurde (Matthäus 4:1-11), ist Frodo mehrfach der Verführung durch den Ring ausgesetzt. Zu Beginn von Die Gefährten des Rings (S. 112) wird Frodo von dem plötzlichen Drang überwältigt, den Ring anzulegen, als sich ein Schwarzer Reiter nähert.
Später, auf dem Gipfel der Zeit, gibt er der Versuchung nach und nutzt sie, wobei er sich beinahe seinen Feinden offenbart (Die Gemeinschaft des Rings, S. 262). Obwohl Christus der Versuchung widersteht, stehen beide Figuren vor intensiven inneren Kämpfen, in denen ein Nachgeben ein katastrophales Scheitern bedeuten würde.
Schließlich ist Frodo, wie Christus, durch seine Erfahrung dauerhaft gezeichnet. Selbst nach der Zerstörung des Rings leidet Frodo noch an seinen Wunden. An Jahrestagen wie dem 6. Oktober, dem Tag, an dem er von einer Morgul-Klinge erstochen wurde, ist Frodo sichtlich krank und bekennt: "Ich bin verwundet; es wird nie wirklich heilen" (Die Rückkehr des Königs, S. 377-78). In ähnlicher Weise behält Christus die Spuren der Kreuzigung zurück, wie man sieht, als er Thomas seine Wunden zeigt (Johannes 20:24-29).
Gandalf: Tod, Auferstehung und der Weiße Reiter
Gandalf ist eine zweite Christusfigur. Nachdem er in Moria gegen den Balrog gekämpft hat und in den vermeintlichen Tod gestürzt ist, wird Gandalf wiederbelebt und kehrt nach Mittelerde zurück, verwandelt von Gandalf dem Grauen zu Gandalf dem Weißen. Diese Verwandlung bringt ihm den Titel Schimmelreiter ein, eine mögliche Anspielung auf Offenbarung 19:11: "Ich sah den Himmel offen und vor mir ein weißes Pferd, dessen Reiter heißt Treue und Wahrheit".
Tolkien schildert Gandalfs dramatische Ankunft in Helms Klamm: "Plötzlich erschien über einem Bergrücken ein weiß gekleideter Reiter, der in der aufgehenden Sonne glänzte... Seht den Schimmelreiter", rief Aragorn. Gandalf ist zurückgekehrt. ("Die zwei Türme", S. 186).
Die auffälligste Parallele zwischen Gandalf und Christus ist ihre gemeinsame Erfahrung von Tod und Auferstehung. Nach seiner Auferstehung sagt Christus in Johannes 20,17 zu Maria Magdalena: "Halte mich nicht zurück, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt", eine Anspielung auf seine bevorstehende Rückkehr in den Himmel. In ähnlicher Weise sagt Gandalf nach seinem tödlichen Kampf mit dem Balrog zu den Gefährten: "Nackt bin ich für kurze Zeit zurückgeschickt worden, bis meine Aufgabe erfüllt ist" ("Die zwei Türme", S. 135). Dies deutet darauf hin, dass auch Gandalf in ein anderes, vielleicht himmlisches Reich übergeht, bevor er als Gandalf der Weiße nach Mittelerde zurückkehrt.
Darüber hinaus ist der Tod beider Figuren von großer symbolischer Bedeutung. Die Kreuzigung Christi besiegt Satan und befreit die Menschheit von der Sünde. Gleichzeitig besiegt Gandalfs Opfer den Balrog, die Verkörperung des uralten Bösen, und befreit seine Gefährten aus der bedrückenden Finsternis von Moria. In beiden Geschichten wird der Tod nicht zu einem Ende, sondern zu einem triumphalen Akt der Befreiung.
Aragorn: Der verborgene König und Heiler
Aragorn, der rechtmäßige Thronfolger von Gondor, erscheint als eine weitere christusähnliche Figur. Obwohl er dazu bestimmt ist, zu herrschen, muss Aragorn erst warten und sich beweisen, bevor er sein Königreich beanspruchen kann. Tolkien deutet Aragorns wahre Identität im Laufe der Geschichte an, obwohl sich die meisten Figuren seiner Bedeutung nicht bewusst sind. Dies spiegelt wider, wie das göttliche Königtum Christi während seiner Zeit auf der Erde verborgen und zukunftsorientiert war.
Dieses Thema der verborgenen Größe spiegelt die Skepsis wider, die Christus entgegengebracht wurde. In Johannes 1:46 fragt Nathanael, als er von Jesus hört: "Nazareth, kann daraus etwas Gutes entstehen? Auch Aragorn, der den Lesern und Figuren als der abgehärtete Wildling "Trancos" vorgestellt wird, wird mit Misstrauen betrachtet. Als Frodo beschließt, sich ihm anzuvertrauen, warnt ihn der Gastwirt von Bree, Barliman Butterbur: "Nun, du magst dich auskennen, aber wenn ich in deiner Lage wäre, würde ich mich nicht mit einem Wildling anlegen" ("Die Gefährten des Rings", S. 229).
Aragorns Rolle als Heiler unterstreicht seine Parallele zu Christus noch weiter. Aragorn, der für seine Fähigkeit bekannt ist, schwere Wunden zu heilen, erfüllt eine alte Prophezeiung Gondors: "Die Hände des Königs sind die Hände eines Heilers, und so wird der rechtmäßige König bekannt werden" ("Die Rückkehr des Königs", S. 169). Im Laufe der Saga heilt Aragorn Merry nach dem Angriff der Schwarzen Reiter, pflegt Frodo nach seiner Verwundung durch Morguls Schwert, hilft seinen Gefährten nach Schlachten und erweckt später Sam und Frodo nach der Tortur auf den Pelennor-Feldern wieder zum Leben. Das Wirken Christi war ebenfalls von wundersamen Heilungen und sogar von der Auferweckung von Toten geprägt und verband das Königtum mit dem Erbarmen.
Indem er diese Eigenschaften in die Figur des Aragorn einwebt, entwirft Tolkien das Bild eines verborgenen Königs, dessen Autorität nicht nur auf Macht, sondern auch auf Dienst und Wiederherstellung beruht - ein eindeutig christliches Bild, das tief in den mythischen Rahmen des Epos eingebettet ist.
Tolkiens Glaube im Herzen von Mittelerde
J.R.R. Tolkiens tiefer katholischer Glaube ist untrennbar mit der Handlung von Der Herr der Ringe verbunden. In einem Brief an seinen Freund Pater Robert Murray räumte Tolkien selbst diesen Einfluss ein und schrieb: "Der Herr der Ringe ist natürlich ein grundlegend religiöses und katholisches Werk; anfangs unbewusst, aber bei der Überarbeitung bewusst. Deshalb habe ich praktisch alle Hinweise auf so etwas wie 'Religion', Kulte oder Praktiken in der imaginären Welt nicht aufgenommen oder gestrichen. Denn das religiöse Element wird von der Geschichte und der Symbolik absorbiert".
Obwohl Tolkien nicht ausdrücklich die Absicht hatte, eine religiöse Geschichte zu schreiben, flossen seine tiefe katholische Erziehung und seine Kenntnis der Heiligen Schrift ganz natürlich in seine Erzählung ein. Das Ergebnis ist ein symbolträchtiges Epos, in dem die biblischen Themen Opfer, Auferstehung, Königtum und Erlösung nachklingen, die subtil, aber kraftvoll in die mythische Welt von Mittelerde eingewoben sind.
Begründer des "Katholizismus-Kaffees".