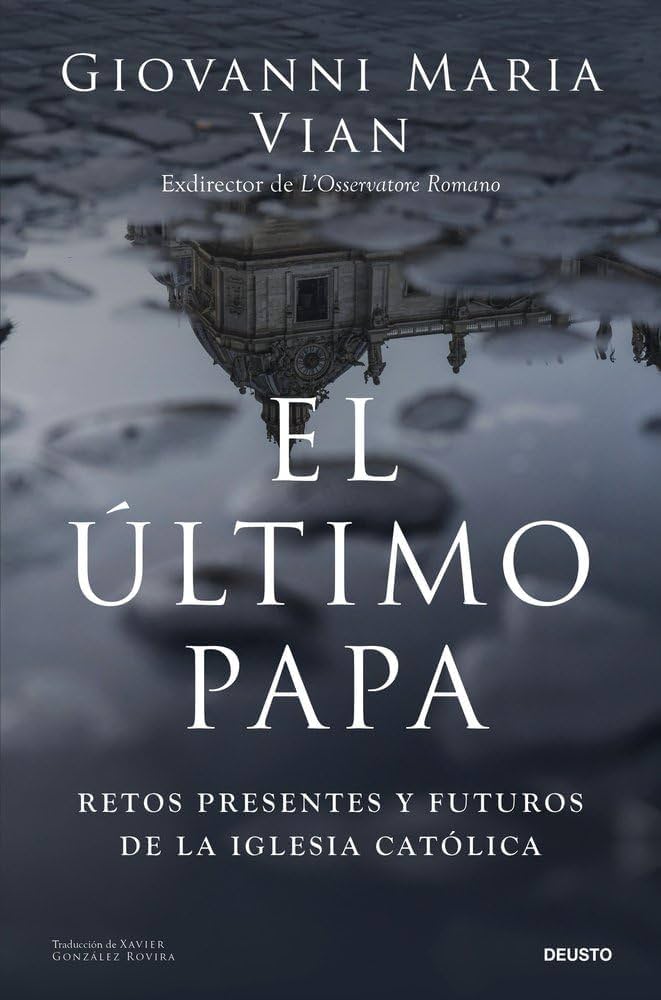Giovanni Maria Vian, Professor für Geschichte der La Sapienza von Rom und ehemaliger Direktor von L'Osservatore Romanohat ein interessantes halb historisches, halb journalistisches Werk über die Entwicklung des Papsttums im 20. und 21. Jahrhundert geschrieben, das sich auf die Arbeit und Organisation der römischen Kurie konzentriert. Das Buch wird journalistisch als Allegorie auf die berühmte apokryphe Prophezeiung des heiligen Malachias über den letzten Papst, der in der Geschichte regieren und "theoretisch" das Ende der Welt einleiten würde und der der Prophezeiung zufolge Johannes XXIV. heißen würde, dargestellt. In Wirklichkeit ist das Buch, abgesehen von Umschlag, Prolog und Epilog, ein Geschichtswerk, das sich auf dokumentarische Quellen aus den Vatikanischen Archiven und auf unterschiedlich strenge Zeugenaussagen stützt.
Eine Lesung der Kirche
Das Buch wurde in der Presse als Kritik an einigen Aspekten des Pontifikats der letzten Päpste von Johannes Paul II. bis heute dargestellt, obwohl es in Wirklichkeit eine Analyse von variablem Wert ist.
Professor Vian, ein Kenner der römischen Kurie und der zeitgenössischen Kirchengeschichte, greift eine Einschätzung auf, die von den großen christlichen Intellektuellen der jüngeren Geschichte, wie Merry del Val, Romano Guardini, Hans Urs von Balthasar und Rahner, reichlich entwickelt wurde, Ratzinger und in jüngerer Zeit von Andrea Riccardi.
Vian zufolge sollte die Kirche den Stil und die Art und Weise der christlichen Gesellschaft aufgeben, d.h. jene, die der Verbindung mit dem Staat entsprechen, die seit der Zeit von Kaiser Konstantin bis heute besteht, um zu erkennen, dass die Trennung von Kirche und Staat unumkehrbar ist und dass die christlichen Wurzeln der Gesellschaft mit großer Geschwindigkeit verschwinden, um in wenigen Jahren vollständig in eine neue nachchristliche globalisierte Zivilisation und Kultur einzutreten.
Als Johannes Paul II. erklärte, die Neuevangelisierung sei "neu in ihrem Eifer, ihrer Methode und ihren Ausdrucksformen", bezog er sich in diesem Sinne auf eine Gesellschaft, die noch christliche Wurzeln hat, die "ent-säkularisiert" und in erheblichem Maße wieder christlich werden kann, d.h. eine menschliche Gesellschaft, die noch christliche Wurzeln hat, die auf dem Evangelium, der griechischen Philosophie und dem römischen Recht beruhen.
Kirche und Dialog mit der Welt
Auch wenn er es nicht ausdrücklich sagt, schlägt Giovanni Maria Vian im Wesentlichen vor, ein neues Drittes Vatikanisches Konzil im Dialog mit der Welt von heute abzuhalten. Gaudium et spes" neu zu schreiben, die heutige westliche Gesellschaft zu analysieren, um ihr zu helfen, erzieherische, anthropologische, philosophische und spirituelle Ansätze zu finden, die die Würde der menschlichen Person aufwerten und einer Gesellschaft im Niedergang Horizonte der Hoffnung eröffnen. Er möchte, dass die Kurie aus ihrer Selbstreferenzialität herauskommt (S. 205) und zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehrt (S. 213).
Es ist wichtig zu erkennen, dass die liberale Gesellschaft ebenso wie die sozialdemokratische Gesellschaft untergegangen ist und wir uns auf eine neue Kultur und Zivilisation zubewegen, in der die kulturellen und sozialen Parameter andere sind.
Es muss entdeckt werden, dass es in der heutigen Gesellschaft große Schichten gibt, die keine größeren Interessen haben als persönliche Selbstbestätigung, moralische Autonomie, Vergnügen und Bequemlichkeit, und dass die erste Welt Solidarität und Auswanderung verachtet, weil sie grausam unsolidarisch geworden ist, gerade weil sie die geistigen Werte aufgegeben hat.
Die Gesellschaft der Ersten Welt zerstört sich selbst mit hoher Geschwindigkeit: Grundwerte wie Liebe, Familie, Freundschaft, Arbeit, Kultur, Gelassenheit, spirituelle und transzendente Ansichten und sogar Ökologie und Umwelt, Frieden.
Die Lösung
Vian scheint zu vergessen, dass die katholische Kirche die Lösung hat: die menschliche und göttliche Person Jesu Christi und seine rettende Lehre. Seine Fähigkeit, zu ziehen und zu verwandeln, Horizonte des Glücks, der grenzenlosen Liebe und der Sorge für die anderen, die Familie, die Welt, die Bedürftigen, die Ausgestoßenen zu entfachen und zu öffnen. Benedikt XVI. hat es sehr anschaulich formuliert: "Wir haben an Gottes Liebe geglaubtSo kann ein Christ die grundlegende Entscheidung seines Lebens ausdrücken. Christ wird man nicht durch eine ethische Entscheidung oder eine große Idee, sondern durch die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die dem Leben einen neuen Horizont und damit eine entscheidende Orientierung gibt" (Deus Caritas est1).
Auf jeden Fall erinnert uns Vian daran, dass es notwendig ist, einen Teil der christlichen Lehre neu zu schreiben, um eine Antwort von Christus auf die wirklichen Probleme zu geben, die die Menschen und vor allem die herrschenden Klassen dieser unserer Welt bedrängen: eine neue Anthropologie, die attraktiv ist und der Würde der Kinder Gottes entspricht, die mit Freiheit und Würde ausgestattet sind (S. 25).
In diesem Zusammenhang wird Vian einige Seiten dem Schlussdokument widmen, mit dem der Papst am 24. November 2024, wenige Monate vor seinem Tod, die Schlussfolgerungen der "Synode der Synodalität" bestätigte. Dieses außergewöhnliche nachsynodale Dokument knüpft sehr gut an aktuelle Befindlichkeiten an, auch bei anderen religiösen Konfessionen und in der sozialen Organisation der Wirtschaft - der Unternehmen - und in der Art und Weise, wie in Teams gearbeitet wird, die sich durchgesetzt hat. Gerade das Schlussdokument, das Vian unterstreicht, spricht zu uns, sich einzubringen und die Kirche als die eigene zu empfinden. Gleichzeitig werden die Bischöfe der ganzen Welt und der Papst als Familienväter über den Kurs der Weltkirche wachen (S. 39).
Logischerweise sind viele der futuristischen Vorschläge, die in diesem Werk dargelegt werden, völlig rechthaberisch und berühren heikle Punkte der kirchlichen Tradition, weshalb sie frei genommen werden müssen, so wie sie natürlich geäußert wurden, zum Beispiel der Vorschlag, die Kunstwerke bestimmter Künstler unserer Zeit zu zerstören, die in schreckliche Rechtsfälle verwickelt sind (S. 47). Schließlich wird er sich direkt mit der Reform der Päpstlichen Kurie, ihren Arbeitsmethoden und ihrem Beitrag an Ideen befassen, die seit dem Kodex von 1917 fortbestehen (S. 98).
Die Kommentare zum Opus Dei sind parteiisch, unpräzise und unterliegen einer falschen Dynamik: Das Opus Dei wollte nie eine Ausnahme sein, noch abseits der Bischöfe leben, noch eine Institution der Macht sein, sondern der Kirche und den Seelen dienen (S. 218).
Der letzte Papst. Gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen für die katholische Kirche.